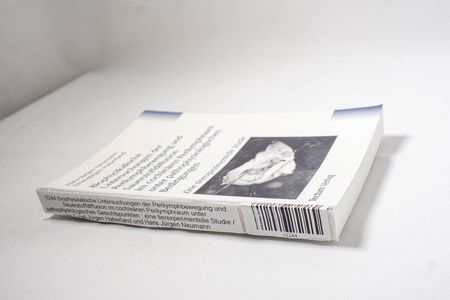Biophysikalische Untersuchungen der Perilymphbewegung und Sauerstoffdiffusion im cochleären Perilymphraum unter pathophysiologischen Gesichtspunkten : eine tierexperimentelle Studie / von Ernst-Jürgen Haberland und Hans Jürgen Neumann
Netto: 23,36 €25€
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Bearbeitungszeit: 3 Werktage
Sofort lieferbar (auf Lager)
1x Stück verfügbar
FAQ zum Buch
Die arterielle Blutversorgung des Innenohrs erfolgt über die A. vertebralis, A. basiliaris und A. cerebellaris anterior inferior, die sich intracochleär als A. labyrinthi weiterentwickeln. Diese verzweigt sich in die A. vestibularis anterior und A. cochlearis communis, die sich weiter in A. vestibulocochlearis und A. spiralis modioli teilen. Die Anatomie der Blutversorgung variiert in Bezug auf Anzahl, Länge, Durchmesser und Verzweigungen. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 13, ISBN 9783828890039
Der Aquaeductus cochleae ist ein anatomischer Kanal im Innenohr, der die Scala tympani mit dem Arachnoidalraum verbindet. Seine Länge und Breite variieren zwischen Tieren und Menschen, wobei beim Menschen eine geringere Durchgängigkeit aufgrund der größeren Länge und kleineren Breite möglich ist. Die Auskleidung mit Dura mater- und Arachnoidea-Ausläufern bildet ein Netzwerk, das möglicherweise eine barriereartige Funktion hat, wobei die Existenz einer “Membrana limitans“ umstritten ist. Bei pathologischer Vergrößerung kann es zu einem schwallartigen Auftreten von Perilymph (Gusher-Phänomen) kommen. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 31, ISBN 9783828890039
Die Kontraktion des Musculus tensor tympani führt zu einer kurzzeitigen Druckspitze im Perilymphraum, die etwa 50 Pa über dem Mittelwert liegt und fünfmal stärker ist als die durch die Atmung bedingte Druckmodulation. Die Kontraktion des Musculus stapedius verursacht hingegen keine deutliche Druckänderung. Beide Muskeln unterscheiden sich in ihren Reflexbögen, histologischen Eigenschaften und Funktionen. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 36, ISBN 9783828890039
Bei den Tierversuchen wird eine Ketanest-Kombinationsnarkose mit Spontanatmung verwendet. Diese Anästhesieform bewirkt eine dissoziative Anästhesie mit Katalepsie, Sedierung, Amnesie und guter Analgesie. Die Augen bleiben während der Narkose offen, und die sensorischen Reflexe sind verzögert. Die Methode entspricht den Anforderungen sinnesphysiologischer Untersuchungen am Hörorgan des Meerschweinchens. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 38, ISBN 9783828890039
Die Plazierung von Glaskapillaren und Elektroden erfolgt nach der Perforation der knöchernen Kapsel der Scala tympani oder Scala vestibuli. Die Bohrlöcher werden in einem Winkel von 30–40° zur Basilarmembran angelegt, wobei besondere Vorsicht bei der Scala vestibuli erforderlich ist, um die REISSNERsche Membran zu schützen. Die Glaskapillaren müssen unmittelbar nach der Perforation platziert werden, um Perilymphaustritt zu minimieren, und sind mit künstlicher Perilymphe ohne Gasblasen zu füllen. Die Fixierung erfolgt strikt. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 49, ISBN 9783828890039