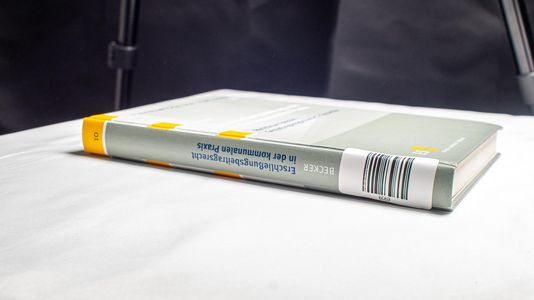Erschließungsbeitragsrecht in der kommunalen Praxis - Ulrich Becker
Netto: 24.48 €26,19€
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Bearbeitungszeit: 3 Werktage
Sofort lieferbar (auf Lager)
1x Stück verfügbar
Buchzusammenfassung:
*Weitere Angaben Verfasser: Zielgruppen: Verwaltungsgerichte, Rechtsanwälte, Kommunen, Kreise (Kommunalaufsicht), Universitäten (jur. Fakultäten), Bibliohteken, Hauseigentümerverbände, kommunale Spitzenverbände
FAQ zum Buch
Das Erschließungsbeitragsrecht regelt die Refinanzierung bestimmter Erschließungsmaßnahmen und ist im 6. Teil des BauGB verankert. Es findet sich in den §§ 127-135 des BauGB, die den Zweiten Abschnitt des 6. Teils bilden. Der 6. Teil trägt den Titel „Erschließung“ und umfasst zudem allgemeine Vorschriften in den §§ 123-126. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 23, ISBN 9783503078486
Die Voraussetzungen für eine wirksame Erschließungsbeitragssatzung umfassen die Existenz einer prinzipiell erschließungsbeitragsfähigen Anlage, die Durchführung einer maßnahme, die über Erschließungsbeiträge refinanziert werden kann, und eine hinreichende satzungsrechtliche Grundlage. Zudem müssen die Verteilungsregelungen und Merkmalsrelevanz der Satzung rechtssicher und verwaltungsgerichtlich überprüfbar sein. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 25, ISBN 9783503078486
Erschließungsbeitragsfähige Anlagen umfassen öffentliche zum Anbau bestimmte Straßen, Wege und Plätze, öffentliche nicht befahrbare Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete, Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete, Parkflächen und Grünanlagen sowie Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 55, ISBN 9783503078486
Beitragspflichtig können Maßnahmen sein, die als selbständige oder unselbständige Schutzanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2 Nr. 5 BauGB erfasst werden. Dies gilt insbesondere für die erstmalige endgültige Herstellung solcher Anlagen, sofern sie im Rahmen der Erschließung eines Baugebietes angelegt werden. Maßnahmen, die nur grundstücksbezogen wirken, wie z. B. Schallschutzfenster, sind dagegen nicht beitragspflichtig. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 74, ISBN 9783503078486
Die Entstehung der sachlichen Beitragspflicht ist die entscheidende Zäsur für die Beitragserhebung, da danach bestimmte rechtliche Instrumente und Entscheidungsmöglichkeiten für die Kommune nicht mehr verfügbar sind. Sie festlegt unveränderbar den Kreis der beitragspflichtigen Grundstücke sowie die Höhe der Beiträge. Zudem ruht der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück und löst die Frist für die Erhebung aus. Der Entstehungszeitpunkt ist maßgeblich für die Anwendung des Satzungsrechts. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 109, ISBN 9783503078486
Die Entstehung der sachlichen Beitragspflicht setzt ein Bündel unterschiedlicher Voraussetzungen voraus, darunter anlagenbezogene und grundstücksbezogene Bedingungen. Eine wirksame Erschließungsbeitragssatzung ist zwingend erforderlich. Die Beitragspflicht ist nicht anlagenbezogen, sondern grundstücksspezifisch zu bestimmen. Die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage allein reicht nicht aus. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 110, ISBN 9783503078486
Die umlagefähigen Kosten für Erschließungsbeiträge werden entweder nach Einheitssätzen oder nach den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt. Die Kommune entscheidet sich in ihrer Satzung für eine der beiden Methoden. Bei der Nutzung von Einheitssätzen erfolgt die Berechnung anhand der in der Satzung festgelegten Sätze, während bei der tatsächlichen Kostenmethode die realen Aufwendungen berücksichtigt werden. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 117, ISBN 9783503078486