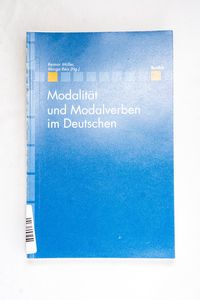
Modalität und Modalverben im Deutschen
Netto: 9,93 €10,63€
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Bearbeitungszeit: 3 Werktage
Sofort lieferbar (auf Lager)
1x Stück verfügbar
FAQ zum Buch
Die Untersuchung argumentiert dagegen, dass die epistemischen Lesarten von Modalverben (MV) im Altdeutschen nicht auf die Entwicklung von Anhebungsstrukturen zurückzuführen sind. Sie zeigt, dass die MV im Altdeutschen zwar fast keine epistemischen Lesarten besitzen, aber in diagnostischen Kontexten wie Impersonalprädikaten oder nicht-referenziellen Subjekten wie Satzkluseln oder Idiomen wie Anhebungsverben funktionieren. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 37, ISBN 9783875482546
Erstens wird die Bewertung der Infinitiv-Partikel “zu“ im Vergleich zum reinen Infinitiv-Anschluss bei Modalverben untersucht. Zweitens wird die Beziehung zwischen den verschiedenen Konstruktionstypen von “scheinen“ im heutigen Deutsch analysiert. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 87, ISBN 9783875482546
Die Hypothese besagt, dass deutsche Modalverben den Kopf einer Aspektphrase innerhalb von mathrm{P}$ bilden, wie von Travis (2000) vorgeschlagen. Dies erklärt ihr aspektuelles Verhalten gegenüber eingebetteten Komplementen und die Zuweisung einer $ heta$-Rolle. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 135, ISBN 9783875482546
Im 16. und 17. Jahrhundert wird das Modalverb „sollen“ in Zeitungen verwendet, um Nachrichten als Berichte aus zweiter Hand zu kennzeichnen. Ein Beispiel ist die Aussage, dass Don Philippo mit dem Schwiegersohn des Herrn Ladigera duelliert und ihn getötet habe, was als zweithandige Information präsentiert wird. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 177, ISBN 9783875482546
Der Text argumentiert, dass das (zu-)Infinitiv, nicht das Hilfsverb, die strukturell relevanten Eigenschaften der Modalen Infinitive trägt. Das zu-Infinitiv führt zu einer modalen Interpretation und einem Passiv-Effekt in bestimmten Kontexten und bewahrt Reste eines Zwecksinhalts. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 217, ISBN 9783875482546
In der Studie zeigten 7- bis 9-jährige Kinder eine bessere Kompetenz im Verständnis von „vielleicht“ als 6-jährige. Bei „können“ schnitten 8- bis 9-jährige besser ab als jüngere Gruppen. Zudem verstanden 6- bis 8-jährige „vielleicht“ signifikant besser als „können“, was auf die komplexe Polyfunktionalität von „können“ hindeutet. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 111, ISBN 9783875482546
Im Deutschen haben „nicht müssen“ und „nicht brauchen“ den gleichen logischen Sinn „nicht (Nec) p“, unterscheiden sich aber semantisch. „Nicht müssen“ drückt „unnotwendige“ Handlungen aus, während „nicht brauchen“ „überflüssige“ Handlungen beschreibt. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 149, ISBN 9783875482546
Laut dem Artikel unterscheiden sich Evidentiale und epistemische Modalität darin, dass Evidentiale sich auf die verfügbare Evidenz beziehen, während epistemische Modalität eine Aussage anhand des Wahrheitsglaubens des Sprechers bewertet. Sie stellen unterschiedliche Thematisierungen der Rolle des Sprechers dar. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 201, ISBN 9783875482546











