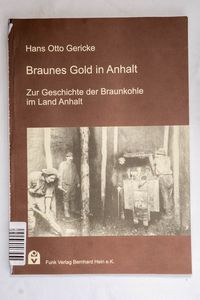Braunes Gold in Anhalt: Zur Geschichte der Braunkohlengewinnung und -verarbeitung in Anhalt von 1700 bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts - Gericke, Hans O
Netto: 7,93 €8,49€
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Bearbeitungszeit: 3 Werktage
Sofort lieferbar (auf Lager)
1x Stück verfügbar
Buchzusammenfassung:
Das Buch "Braunes Gold in Anhalt: zur Geschichte der Braunkohlengewinnung und -verarbeitung im Gebiet von Anhalt von etwa 1700 bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts" von Hans Otto Gericke behandelt die Geschichte der Braunkohleförderung und -verarbeitung in der Region Anhalt. Im ersten Kapitel wird auf die Eigenschaften der Braunkohle als Brennstoff und ihre vielseitige Verwendung eingegangen. Es wird erklärt, wie die Braunkohle als Energiequelle genutzt wurde und welche Vorteile sie gegenüber anderen Brennstoffen hatte. Im zweiten Kapitel wird ein Überblick über die einstigen Braunkohlenlagerstätten in Anhalt gegeben. Es werden die verschiedenen Vorkommen und ihre geografische Lage beschrieben. Das dritte Kapitel behandelt die ersten vereinzelten Abbauversuche von anhaltischer Braunkohle im 18. Jahrhundert. Es wird auf die technischen Herausforderungen und die ersten Erfolge beim Abbau der Kohle eingegangen. Im vierten Kapitel wird der Beginn einer kontinuierlichen Kohlenförderung in den ersten Gruben Anhalts seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts beschrieben. Es wird auf die Entwicklung der Bergbauindustrie und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kohleabbaus eingegangen. Das fünfte Kapitel behandelt den bedeutenden Aufschwung der Braunkohleförderung in den fünfziger und sechziger Jahren. Es wird erklärt, wie sich die Technologie und die Produktionsmethoden verbesserten und zu einem Anstieg der Förderleistungen führten. Im sechsten Kapitel wird das weitere Anwachsen der anhaltischen Braunkohlenförderung bis zur Jahrhundertwende beschrieben. Es werden die verschiedenen Gruben und ihre Fördermengen vorgestellt. Das siebte Kapitel behandelt die höchsten Förderleistungen in Anhalt vor dem Ersten Weltkrieg. Es wird auf die wirtschaftliche Bedeutung des Kohleabbaus für die Region eingegangen. Das achte Kapitel beschäftigt sich mit der Zeit des Ersten Weltkrieges und den Auswirkungen auf die Braunkohlenindustrie. Es wird erklärt, wie der Krieg die Produktion beeinflusste und welche Schwierigkeiten die Bergbauunternehmen zu bewältigen hatten. Im neunten Kapitel wird die Stagnation und Umstrukturierung der Produktion in der Weimarer Zeit behandelt. Es wird auf die wirtschaftlichen Herausforderungen und die Veränderungen in der Bergbauindustrie eingegangen. Das zehnte Kapitel beschäftigt sich mit der Rolle der anhaltischen Braunkohle in der faschistischen Kriegswirtschaft. Es wird erklärt, wie die Kohle für die Rüstungsproduktion genutzt wurde und welche Auswirkungen dies auf die Region hatte. Der kurze Epilog gibt einen Überblick über die Entwicklung der Braunkohleförderung in Anhalt bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Das Buch enthält außerdem einen Tabellenanhang, Anmerkungen, ein Glossar und ein Impressum.
FAQ zum Buch
Die eigentliche Entwicklung des Braunkohlenbergbaus in Preußlitz begann im Jahr 1819, als der bisher landesherrliche Besitz an eine Gewerkschaft unter der Regie der Gewerken Kuhn und Lücke veräußert wurde. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 17, ISBN 9783936124576
Im Jahr 1850 wurde das „Provisorische Gesetz für die Herzogtümer Anhalt-Dessau und Anhalt-Köthen“ erlassen, das den Bergbau regulierte. Es unterschied zwischen Bergwerken (z. B. Braunkohle) und Gräberei (z. B. Sand, Kies) und legte fest, dass Bergwerke unter staatlicher Kontrolle standen, während Gräberei dem Grundbesitzer gehörte. Dies sicherte den Bergbau unter strengen Bedingungen und erhöhte die Abgaben für Betreiber. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 26, ISBN 9783936124576
Die „Gründerkrise“ führte zu einer Stagnation der Förderung, verschärfter Konkurrenz zwischen den Gruben und einem Rückgang der durchschnittlichen Preise für die verkaufte Kohle. Dieses Phänomen wird durch ein Schreiben der Vereinigten Chemischen Fabriken aus dem Jahr 1877 an die herzogliche Bergverwaltung dokumentiert. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 46, ISBN 9783936124576
Der Rückgang der Braunkohlenförderung in Anhalt während des Ersten Weltkrieges wurde vor allem durch die Mobilisierung von Bergleuten in die Armee und die Überlastung der Eisenbahnen für Militärtransporte verursacht. Diese Faktoren führten zu personellen Lücken in den Gruben und zu Verzögerungen im Abtransport von Kohle und Rohstoffen. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 76, ISBN 9783936124576
Im 19. Jahrhundert gab es in den Landkreisen Köthen, Bernburg, Ballenstedt und Zerbst einen Abbau von Braunkohlenlagerstätten. Der Kreis Dessau war die Ausnahme, da dort kein entsprechender Abbau stattfand. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 12, ISBN 9783936124576
Der Braunkohlenabbau in Anhalt verlief früher rückläufig, da viele Vorkommen einen hohen Anteil „klarer“ Kohlen enthielten, die beim Verkauf nur geringen Erlös brachten. Zudem war die Überdeckung der Kohlenflöze durch Abraum oft ungünstig, was den Abbau wirtschaftlich weniger vorteilhaft machte. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 14, ISBN 9783936124576
Der geringere Heizwert der Braunkohle im Vergleich zur Steinkohle resultiert aus einem niedrigeren Inkohlungsgrad und einem bis zu 50 % hohen Wassergehalt. Dies führt zu einem durchschnittlichen Heizwert von 2000–3000 kcal, während Steinkohle bis zu 7000–8000 kcal erreicht. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 5, ISBN 9783936124576
Im Jahr 1900 erreichte Anhalt mit über 1,3 Millionen geförderter Rohbraunkohle einen neuen Spitzenwert. Dies markierte den ersten Höhepunkt der jährlichen Förderung des kleinen Bundesstaates. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 69, ISBN 9783936124576