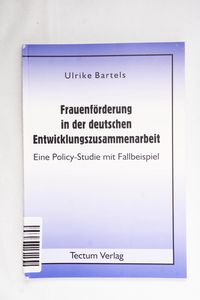Frauenförderung in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit - Bartels, Ulrike
Netto: 11.52 €12,33€
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Bearbeitungszeit: 3 Werktage
Sofort lieferbar (auf Lager)
1x Stück verfügbar
Buchzusammenfassung:
Ebenso wie in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit spielten Frauen in den Konzeptionen und Maßnahmen der deutschen Entwicklungspolitik bis in die siebziger Jahre lediglich eine untergeordnete Rolle, auch wenn Frauen am stärksten von Armut betroffen sind. Sofern es vor 1975 Projekte gab, die sich gezielt an Frauen richteten, waren diese sozialkaritativ ausgerichtet und orientierten sich an der reproduktiven Rolle von Frauen als Hausfrau und Mutter. Die vorliegende Arbeit zeichnet die Geschichte der Frauenförderung in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit nach.. Dabei werden insbesondere die inhaltlichen Positionen des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) analysiert und der konzeptionelle Wandel von Frauenförderung zu Gender-Ansatz nachvollzogen. Wie Frauenförderung und Gender-Ansatz in einem konkreten Projekt vor Ort umgesetzt werden, wird an einem Fallbeispiel der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit in Kolumbien dargestellt.
FAQ zum Buch
Bevölkerungskontrollen, insbesondere Geburtenkontrollen, wurden in den 1960er-Jahren als Lösung für Ressourcenverknappung angesehen und richteten sich vor allem an Frauen. Dies führte dazu, dass Frauen als neue Zielgruppe der Entwicklungspolitik betrachtet wurden, da Bevölkerungskontrollen nur im Rahmen von integrierten Maßnahmen wie medizinischer und schulischer Versorgung umgesetzt werden konnten. Die Grundbedürfnisstrategie ergänzte dies, indem sie Frauen als zentrale Akteure in Entwicklungsbemühungen einbezog, um soziale und wirtschaftliche Bedürfnisse zu adressieren. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 24, ISBN 9783828884267
Die Thematisierung der Rolle von Frauen im BMZ war bis in die 1970er Jahre marginal und konzentrierte sich auf sozialkaritative Maßnahmen, die die reproduktive Rolle von Frauen betonten. Erst in den späten 1970er Jahren gewann der Frauenaspekt durch internationale Entwicklungen wie das UN-Frauenjahr und die deutsche Frauenbewegung an Bedeutung. Gesetzliche Veränderungen und Studien zur Frauenfrage trugen zur verstärkten Wahrnehmung von Frauenbelangen in der Entwicklungspolitik bei. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 35, ISBN 9783828884267
Die Grundsatzpapiere des BMZ haben sich von der Förderung von Frauen zu Gleichberechtigung verändert. Das erste Papier aus dem Jahr 1978 betonte die Schlüsselrolle von Frauen in Bereichen wie Ernährung und Bildung sowie ihre notwendige Beteiligung an Entwicklung. Die nachfolgenden Konzepte erweiterten den Fokus auf strukturelle Gleichberechtigung und integrierten internationale Entwicklungen. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 53, ISBN 9783828884267
Die GTZ verankerte die Frauenförderung institutionell in ihrer Unternehmensstruktur und setzte sie auf der Projektebene um. Dies umfasste die Entwicklung neuer Arbeitsmaterialien sowie die Fortbildung der MitarbeiterInnen. Der Prozess der Politikumsetzung erfolgte auf mehreren Ebenen der Organisation. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 66, ISBN 9783828884267