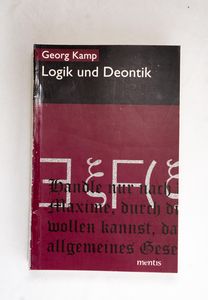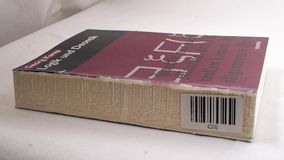Logik und Deontik
Netto: 18.69 €20,00€
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Bearbeitungszeit: 3 Werktage
Sofort lieferbar (auf Lager)
1x Stück verfügbar
Buchzusammenfassung:
Das Buch "Logik und Deontik: Über die sprachlichen Instrumente praktischer Vernunft" von Georg Kamp behandelt verschiedene Themen im Zusammenhang mit praktischem Argumentieren und den sprachlichen Instrumenten der Vernunft. In der Einleitung gibt der Autor einen Überblick über die Themen des Buches und erklärt, dass es um Regeln für praktisches Argumentieren geht. Er erwähnt auch die Deontische Logik und die Imperativlogik als relevante Angebote in diesem Bereich. Des Weiteren erwähnt er den skeptischen Standpunkt des mormenlogischen Skeptizismus und gibt einen Überblick über den Argumentationsgang des Buches. Im ersten Kapitel geht es um Folgerbarkeit, Wahrheit und praktische Argumentationen. Der Autor gibt einen historischen Überblick über die Bereiche von Aristoteles und die Weichenstellungen von G. Frege. Er diskutiert das Dilemma von J. Jergensen, ob es praktische Argumentationen gibt und ob sie sprachliche Täuschungen sind. Der Autor argumentiert, dass es praktische Argumentationen geben sollte und gibt einige allgemeine Strategien und Werkzeuge dafür an. Im zweiten Kapitel behandelt der Autor das Thema Folgerbarkeit. Er gibt einen Überblick über die Problemlage und diskutiert die traditionelle Folgerbarkeitskonzeption. Er erwähnt auch das Dilemma von Jorgensen und verschiedene syntaktische und semantische Folgerbarkeitskonzeptionen. Der Autor diskutiert auch die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse und verschiedene Bedeutungskonzeptionen. Im dritten Kapitel geht es um das Thema Wahrheit. Der Autor gibt einen Überblick über die Problemlage und diskutiert nicht-korrespondistische Wahrheitskonzeptionen. Er diskutiert auch verschiedene Wahrheitsträger-Kandidaten und ihre philosophischen und gemeinsprachlichen Intuitionen. Der Autor diskutiert auch Aussagen als Wahrheitsträger und rekonstruiert den Begriff "Sachverhalte". Im vierten Kapitel werden Anforderungen an praktische Sprachen behandelt. Der Autor diskutiert die Neutralitäts-Maxime, die Maxime der Desiderat-Orientiertheit, die Maxime der Usus-Orientiertheit und die Maxime der Akzeptanz-Orientiertheit. Im fünften Kapitel behandelt der Autor die Rechtfertigbarkeitsdefizite der deontischen Logik. Er gibt einen Überblick über die Problemlage und diskutiert die deontisch-logisch organisierte Sprache LD. Der Autor diskutiert auch deontisch perfekte Welten, die Analogieunterstellung, die Rosssche Paradoxie und Befolgungssemantiken. Er diskutiert auch die Rekonstruktionsproblematik und verschiedene Verwendungsweisen des Wortes "oder". Im sechsten Kapitel präsentiert der Autor eine Neuorientierung. Er diskutiert die Orientierungsrichtung und verschiedene verwendete Redeteile. Er stellt das Sprachenschema Lp vor und diskutiert das Inventar, die Syntaktik, die Logik, die Axiomatik, die Definitorik und die Alethik von Lp. Der Autor gibt auch Beispielbetrachtungen und diskutiert handlungsthematisierende Rede und normative Aussagen von Lp. Er diskutiert auch die Deontik von Lp und praktische Sprachen. Das Buch endet mit einem Literaturverzeichnis, einem Personenregister und einem Sachregister.
FAQ zum Buch
Der Text betont, dass Symbolik erst entstehen sollte, um einem bestehenden Bedürfnis zu entsprechen, und dass der Schöpfer von Symbolik diese Bedürfnisse zuerst studieren muss. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, dass theoretische Konzepte praktischen Anforderungen folgen sollten. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 11, ISBN 9783897851979
Die Rosssche Paradoxie beschreibt ein Problem in der deontischen Logik, bei dem aus der Pflicht, einen bestimmten Akt zu vollziehen (z. B. einen Brief zu übergeben), impliziert wird, dass auch ein unerwünschter Akt (z. B. einen Brief zu verbrennen) erlaubt oder geboten wäre. Dies ist umstritten, da es zu unerwarteten oder kontraintuitiven Schlussfolgerungen führt, die die logische Struktur der deontischen Aussagen in Frage stellen. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 246, ISBN 9783897851979
Die atomaren Ausdrücke der Sprache L^p müssen an spezifische praktische Redebedürfnisse angepasst werden, indem sie die Prädikatoren „ist geboten“, „ist erlaubt“ und „ist verboten“ einbeziehen. Die Performatoren dienen dazu, Äußerungen nach ihrem Redemodus zu klassifizieren, ähnlich wie in institutionellen Kontexten. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 293, ISBN 9783897851979
Das Ziel der letzten Kapitel war es, zu zeigen, dass es entsprechende Folgerbarkeits- und Wahrheitskonzeptionen gibt, die die praktische Argumentation ermöglichen. Es ging nicht darum, eine bestimmte Konzeption zu verteidigen, sondern den Bedarf an solchen Konzepten zu unterstreichen. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 199, ISBN 9783897851979
Der Text nennt mehrere Gründe für das Fehlen einer einheitlichen Ausgestaltung der deontischen Logik: Zum einen gibt es zahlreiche unterschiedliche Vorschläge zur Folgerbarkeitsreglements, zum anderen führen Paradoxien wie die Ross“sche, Chisholmsche und Priorsche Paradoxie zu unterschiedlichen Lösungsansätzen. Dies führt dazu, dass keine allgemein akzeptierte Form der deontischen Logik existiert. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 218, ISBN 9783897851979
Elementare normative Aussagen in L^P entstehen durch die Anwendung eines 1-stelligen normativen Prädikators auf einen geschlossenen handlungs(token)-thematisierenden Term. Dies wird durch die Formel [6.4-5] beschrieben, die besagt, dass eine Aussage genau dann elementar normativ ist, wenn sie durch die Anwendung eines solchen Prädikators auf einen entsprechenden Term entsteht. Dieses FAQ wurde mit KI erstellt, basierend auf der Quelle: S. 355, ISBN 9783897851979